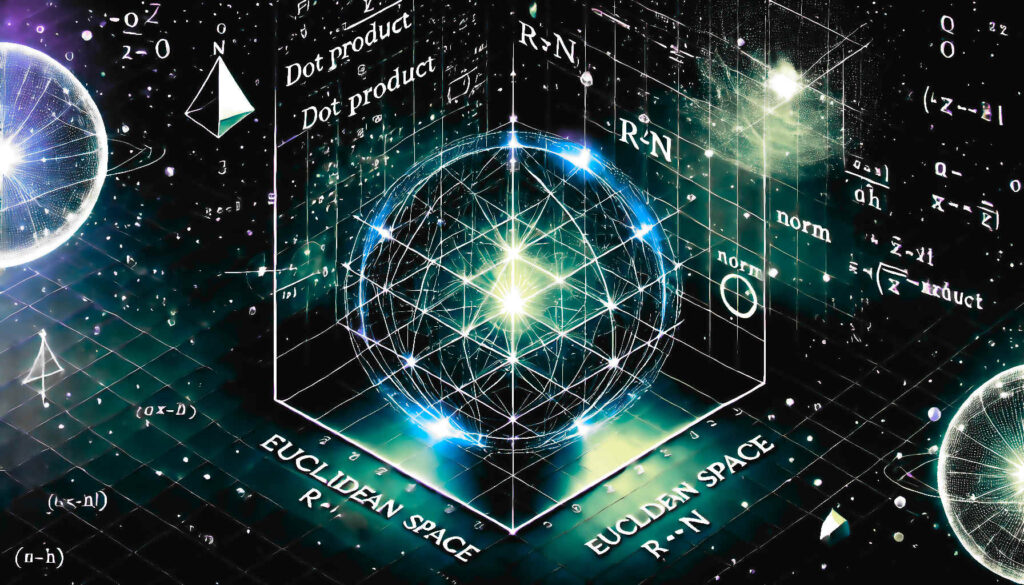Der Euklidische Raum {\mathbb{R}^n}
In dieser Lektion erkunden wir den euklidischen Raum \mathbb{R}^n, seine algebraische Struktur und metrischen Eigenschaften. Du wirst etwas über Vektoroperationen, das Skalarprodukt, die Norm und die euklidische Distanz lernen – essentielle Konzepte in Geometrie und Analysis. Mit klaren Erklärungen und anschaulichen Beispielen wird dir dieses Material helfen zu verstehen, wie man den Raum in mehreren Dimensionen mathematisch modelliert.
Lernziele:
Am Ende dieser Lektion wird der Studierende in der Lage sein:
- den euklidischen Raum \mathbb{R}^n und seine grundlegenden Eigenschaften zu definieren.
- die Vektorstruktur von \mathbb{R}^n anhand seiner Grundoperationen zu erklären.
- das Skalarprodukt anzuwenden, um Winkel und Projektionen zwischen Vektoren zu berechnen.
- algebraische und metrische Eigenschaften des Skalarprodukts in \mathbb{R}^n zu beweisen.
- die euklidische Norm zur Bestimmung der Länge eines Vektors zu verwenden.
- die euklidische Distanz zwischen zwei Punkten in \mathbb{R}^n zu berechnen und ihre geometrische Bedeutung zu analysieren.
- die Gültigkeit grundlegender Ungleichungen wie der Cauchy-Schwarz-Ungleichung und der Dreiecksungleichung zu überprüfen.
INHALTSVERZEICHNIS
Der Raum \mathbb{R}^n
Das Skalarprodukt
Die Norm und die Euklidische Distanz
Schlussfolgerung
Der Vektorraum \mathbb{R}^n
Sicherlich warst du vor diesem Punkt bereits mit den Eigenschaften von \mathbb{R}, der Ebene \mathbb{R}^2, oder dem Raum \mathbb{R}^3 vertraut. All diese Ideen sind nützlich, um den Raum \mathbb{R}^n zu verstehen. Zunächst ist die Menge \mathbb{R}^n = \{\vec{x} = (x_1, \cdots, x_n) | x_1, \cdots, x_n \in \mathbb{R}\}, ausgestattet mit den üblichen Operationen der Vektorsumme und der Skalaren Multiplikation, ein Vektorraum. Lassen Sie uns dies näher betrachten, indem wir die Grundoperationen von \mathbb{R}^n überprüfen.
Grundoperationen von \mathbb{R}^n
Seien \vec{x}=(x_1, \cdots, x_n), \vec{y}=(y_1, \cdots, y_n) Vektoren aus \mathbb{R}^n und \alpha ein beliebiger reeller Skalar, dann sind die Operationen der Vektorsumme und der Skalarmultiplikation wie folgt definiert:
Vektorsumme: Die Vektorsumme wird durch die Funktion beschrieben:
\begin{array}{rcrl} +:& \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \\ & (\vec{x},\vec{y}) & \longmapsto & \vec{x}+\vec{y} = (x_1+y_1, \cdots, x_n + y_n) \end{array}
Skalarmultiplikation: Die Skalarmultiplikation wird durch die Funktion beschrieben:
\begin{array}{rcrl} ():& \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \\ & (\alpha,\vec{x}) & \longmapsto & (\alpha\vec{x}) = (\alpha x_1, \cdots, \alpha x_n) \end{array}
Vektorraum-Eigenschaften von \mathbb{R}^n
Der Raum \mathbb{R}^n, versehen mit den oben beschriebenen Operationen, ist ein Vektorraum, da seine Operationen der Addition und Skalarmultiplikation die folgenden Eigenschaften erfüllen:
Zunächst haben wir die kommutative und assoziative Eigenschaft.
\vec{x} + \vec{y} = \vec{y} + \vec{x} \\ \vec{x} + (\vec{y} + \vec{z}) = (\vec{x} + \vec{y}) + \vec{z} \\ (\alpha \beta) \vec{x} = \alpha (\beta \vec{x}) = \beta (\alpha \vec{x}) = (\beta\alpha) \vec{x}
Die Addition von Skalaren ist distributiv bezüglich der Skalarmultiplikation, und die Vektoraddition ist distributiv bezüglich der Skalarmultiplikation; das heißt, es gelten die folgenden Gleichungen:
(\alpha + \beta) \vec{x} = \alpha\vec{x} + \beta\vec{x} \\ \alpha(\vec{x} + \vec{y}) = \alpha\vec{x} + \alpha\vec{y}
Es existiert ein additives neutrales Element \vec{0}=(0,\cdots, 0), das die Eigenschaft erfüllt:
\vec{x} + \vec{0} = \vec{x}
Es existiert ein multiplikatives neutrales Element für die Skalarmultiplikation:
1 \vec{x} = \vec{x}
Und jeder Vektor \vec{x}\in\mathbb{R}^n besitzt ein additives Inverses -\vec{x}, das die folgende Eigenschaft erfüllt:
\vec{x} + -\vec{x} = \vec{0}
Das Skalarprodukt
Wenn wir die Konstruktion von \mathbb{R}^n als Vektorraum betrachten, sehen wir, dass darin kein Produkt zwischen Vektoren definiert ist; zunächst können wir Vektoren nicht „multiplizieren“, wie wir es normalerweise mit zwei reellen Zahlen tun würden. Es ist jedoch möglich, eine solche Operation zwischen Vektoren zu definieren, und eine Möglichkeit dies zu tun, ist über das sogenannte Skalarprodukt.
Das Skalarprodukt darf nicht mit der Skalarmultiplikation verwechselt werden, das erste ist ein Produkt zwischen zwei Vektoren, das einen Skalar ergibt, und das zweite ist das Produkt eines Skalars mit einem Vektor, was wiederum einen Vektor ergibt. Betrachten wir zwei Vektoren aus \mathbb{R}^n: \vec{x}=(x_1, \cdots, x_n) und \vec{y}=(y_1, \cdots, y_n). Das Skalarprodukt von \vec{x} mit \vec{y}, also \vec{x}\cdot\vec{y},, wird definiert als die reelle Zahl, die durch die folgende Formel gegeben ist:
\vec{x}\cdot\vec{y} =\displaystyle \sum_{i=1}^n x_i y_i = x_1y_1 + \cdots x_ny_n
Es gibt viele Möglichkeiten, das Skalarprodukt zwischen Vektoren aus \mathbb{R}^n darzustellen. Eine ist die oben betrachtete, eine andere ergibt sich unter Berücksichtigung einer Basis von \mathbb{R}^n und des Einstein’schen Summenkonvention: Wenn \{\hat{e}_i\}_{i=\overline{1,n}} eine Basis von \mathbb{R}^n ist (gewöhnlich die kanonische Basis), dann können die Vektoren \vec{x} und \vec{y} wie folgt geschrieben werden:
\vec{x}=\displaystyle\sum_{i=1}^n x_i\hat{e}_i = x_1\hat{e}_1 + \cdots x_n\hat{e}_n
\vec{y}=\displaystyle\sum_{i=1}^n y_i\hat{e}_i = y_1\hat{e}_1 + \cdots y_n\hat{e}_n
Hierbei wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Koeffizienten x_i und y_i der Vektoren relativ zur Basis des Raumes sind.
Einstein’sche Summenkonvention
Die Einstein’sche Summenkonvention erlaubt es uns, die Darstellung von Vektoren im Allgemeinen und des Skalarprodukts im Besonderen zu vereinfachen. Wenn wir die beiden obigen Ausdrücke betrachten, sehen wir, dass der Index i sowohl im Koeffizienten des Vektors als auch im Basisvektor auftaucht. Für Einstein genügt das Vorhandensein von wiederholten Indizes, um die Existenz der Summe in der Darstellung anzunehmen, sodass man schreiben kann:
\vec{x}= x_i\hat{e}_i
\vec{y}= y_i\hat{e}_i
Unter Verwendung dieser Notationskonvention nimmt das Skalarprodukt die folgende Form an:
\vec{x}\cdot\vec{y} = x_i\hat{e}_i \cdot y_i\hat{e}_i = x_iy_i \underbrace{(\hat{e}_i \cdot \hat{e}_i)}_{=1} = x_iy_i
In dieser letzten Gleichung wird angenommen, dass mit der kanonischen Basis gearbeitet wird.
Weitere Notationen für das Skalarprodukt
Die Notation für Vektoren und deren Operationen ist nicht in allen Kontexten gleich, diejenige, die ich in den ersten Absätzen dieses Abschnitts verwendet habe, ist die am häufigsten verwendete im Bereich der Analysis. In der linearen Algebra unterscheidet man jedoch gelegentlich zwischen Vektoren und Kovektoren:
Wenn wir von Vektoren sprechen, meinen wir das, was als „Spaltenvektor“ verstanden wird, und sie werden in Matrixform wie folgt dargestellt:
\alpha^i = \left( \begin{array}{c}\alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{array} \right)
Wenn wir hingegen von Kovektoren sprechen, meinen wir den sogenannten „Zeilenvektor“, der wie folgt dargestellt wird:
\beta_i = \left( \beta_1 \; \cdots \; \beta_n \right)
So wird das Skalarprodukt zweier Vektoren \vec{x}=(x_1,\cdots,x_n) und \vec{y}=(y_1,\cdots,y_n) als Matrixprodukt des „Kovektors“ x_i mit dem Vektor y^i interpretiert, was die folgende reelle Zahl ergibt:
\left( x_1 \; \cdots \; x_n \right) \left( \begin{array}{c}y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{array} \right) = x_iy^i
Beachte, dass in dieser letzten Gleichung erneut die Einstein’sche Summenkonvention auftaucht – die wiederholten Indizes zeigen an, dass das Endergebnis eine Summe ist.
Die Notation, die Vektoren und Kovektoren mittels Unter- und Oberindizes unterscheidet, ist als „kovariante Notation“ oder „Tensor-Notation“ bekannt und wird häufig beim Studium der speziellen und allgemeinen Relativitätstheorie verwendet. Sie hat zudem den Vorteil, die Arbeit mit Tensoren zu erleichtern – einem Konzept, das eine Verallgemeinerung der hier behandelten Inhalte darstellt und das wir zu einem späteren Zeitpunkt im Detail betrachten werden. In anderen Disziplinen wie der Quantenmechanik wird hingegen bevorzugt die Bra-Ket-Notation verwendet, wobei gilt:
\left< x \right| =\left( x_1 \; \cdots \; x_n \right) \\ \\ \left|y\right> = \left( \begin{array}{c}y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{array} \right)
Sodass das Skalarprodukt in der Form \left<x|y\right> dargestellt wird.
Eigenschaften des Skalarprodukts
Aus der Definition des Skalarprodukts lassen sich eine Reihe von Eigenschaften ableiten, die in der Zukunft von großer Bedeutung sein werden.
Wenn wir das Skalarprodukt zur Definition der Funktion \tilde{\omega}(\vec{x})=\vec{\omega} \cdot \vec{x} = \omega_i x^i verwenden, sehen wir, dass die so definierte Funktion \tilde{\omega} alle Eigenschaften linearer Abbildungen besitzt, da sich leicht zeigen lässt, dass
\begin{array}{rl} \tilde{\omega}(\alpha \vec{x} + \beta\vec{y}) = \alpha \tilde{\omega}(\vec{x}) + \beta\tilde{\omega}(\vec{y}) \end{array}
und aus diesem Grund nennt man Objekte wie \tilde{\omega}, die sich aus dem Skalarprodukt definieren lassen, lineare Funktionale. Wie wir bereits wissen, ist \vec{x} ein Vektor im Vektorraum \mathbb{R}^n, und wie wir in anderen Zusammenhängen sehen werden, ist \tilde{\omega} ein Objekt im dualen Raum von \mathbb{R}^n.
Daraus ergibt sich eine enge Beziehung zwischen dem Skalarprodukt und linearen Abbildungen; tatsächlich lässt sich alles Wesentliche über das Skalarprodukt in der folgenden Aussage zusammenfassen: „Das Skalarprodukt ist eine bilineare, symmetrische, positive und nicht-degenerierte Form.“ Schauen wir uns an, was jede dieser Eigenschaften bedeutet:
Wenn wir sagen, dass das Skalarprodukt eine bilineare Form ist, meinen wir, dass für \vec{x},\vec{y} und \vec{z} Vektoren in \mathbb{R}^n und \alpha,\beta \in \mathbb{R} die folgenden zwei Gleichungen erfüllt sind:
\begin{array}{rl} \vec{x}\cdot(\alpha \vec{y} + \beta\vec{z}) = \alpha (\vec{x}\cdot\vec{y}) + \beta(\vec{x}\cdot\vec{z}) \\ \\ (\alpha \vec{x} + \beta\vec{y})\cdot\vec{z} = \alpha (\vec{x} \cdot \vec{z}) + \beta(\vec{y}\cdot\vec{z}) \end{array}
Das Skalarprodukt ist symmetrisch, weil:
\forall(\vec{x},\vec{y}\in\mathbb{R}^n)(\vec{x}\cdot\vec{y} = \vec{y}\cdot\vec{x})
Es ist positiv definit, weil:
(\forall\vec{x}\in\mathbb{R}^n)(\vec{x}\cdot\vec{x} \geq 0)
Und schließlich ist es nicht-degeneriert, weil:
\vec{x}\cdot\vec{x} = 0 \leftrightarrow \vec{x}=\vec{0}
Die Norm und die Euklidische Distanz
Eine Norm ist eine Methode, die Größe eines Vektors zu messen, wenn ein Vektorraum mit einer Norm ausgestattet ist, nennt man ihn einen normierten Vektorraum. Wenn \vec{x},\vec{y}\in\mathbb{R}^n und \lambda\in\mathbb{R} sind, dann ist die Funktion Norm( . ) eine Norm, wenn sie die folgenden Eigenschaften erfüllt:
- Norm(\vec{x})\geq 0
- Norm(\vec{x}) = 0 \leftrightarrow \vec{x}=\vec{0}
- Norm(\lambda\vec{x}) = |\lambda| Norm(\vec{x})
- Norm(\vec{x} + \vec{y}) \leq Norm(\vec{x}) + Norm(\vec{y})
Ein wichtiger Aspekt des Skalarprodukts ist, dass es besonders nützlich ist, um ein mathematisches Distanzkonzept zu definieren, das unserer natürlichen Vorstellung von Abstand zwischen zwei Punkten entspricht. Für jedes \vec{x}\in\mathbb{R}^n wird die euklidische Norm \|\vec{x}\| durch die folgende Gleichung definiert:
\|\vec{x}\| = \sqrt{\vec{x}\cdot\vec{x}}
Auf dieser Grundlage sagen wir, dass die euklidische Norm die vom Skalarprodukt induzierte Norm ist.
Eine Distanz oder Metrik ist eine Funktion, die den „Abstand zwischen zwei Elementen einer Menge“ beschreibt. Wenn \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}\in\mathbb{R}^n und \lambda\in\mathbb{R} sind, dann ist die Funktion Dist( . ) eine Metrik, wenn sie die folgenden Eigenschaften erfüllt:
- Dist(\vec{x},\vec{y})=0 \leftrightarrow \vec{x}=\vec{y}
- Dist(\vec{x},\vec{y})=Dist(\vec{y},\vec{x})\geq 0
- Dist(\vec{x},\vec{z})\leq Dist(\vec{x},\vec{y}) + Dist(\vec{y},\vec{z})
Der letzte Ausdruck ist als Dreiecksungleichung bekannt. Sollte diese Eigenschaft nicht erfüllt sein, so wäre die Funktion Dist(.) das, was man als „Pseudodistanz“ oder „Pseudometrik“ bezeichnet. Ein Vektorraum, der mit einer Metrik ausgestattet ist, wird als metrischer Raum bezeichnet.
Ausgehend von der euklidischen Norm wird die euklidische Distanz zwischen zwei Vektoren definiert. Wenn wir zwei Vektoren \vec{x},\vec{y}\in\mathbb{R}^n haben, dann ist die euklidische Distanz zwischen diesen beiden Vektoren, dist_e(\vec{x},\vec{y}), gegeben durch:
dist_e(\vec{x},\vec{y}) = \|\vec{x} - \vec{y}\|
Wenn \vec{x}=(x_1,\cdots,x_n) und \vec{y}=(y_1,\cdots, y_n), dann lässt sich leicht anhand der Eigenschaften des Skalarprodukts und der Norm zeigen, dass:
dist_e(\vec{x},\vec{y}) = \sqrt{\displaystyle \sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}
Wenn wir den Vektorraum \mathbb{R}^n mit der euklidischen Distanz ausstatten, erhalten wir einen euklidischen Raum.
Daraus ergibt sich: Die Metrik des euklidischen Raumes ist die von der euklidischen Norm induzierte Metrik.
Eigenschaften der euklidischen Norm
Da unser Studium sich speziell auf den euklidischen Raum konzentriert, ist es sinnvoll, die Eigenschaften der euklidischen Norm zu untersuchen.
Cauchy-Schwarz-Ungleichung
Wenn \vec{x},\vec{y}\in\mathbb{R}^n, dann gilt die folgende Eigenschaft:
|\vec{x}\cdot\vec{y}|\leq \|\vec{x}\|\|\vec{y}\|
BEWEIS:
Sei \lambda = (\vec{x}\cdot\vec{y})/\|\vec{y}\|^2, dann gilt:
\begin{array}{rl} 0\leq \|\vec{x} - \lambda \vec{y}\|^2 &= (\vec{x} - \lambda\vec{y}) \cdot (\vec{x} - \lambda\vec{y}) \\ \\ \displaystyle &= \vec{x}\cdot\vec{x} - \lambda\vec{x}\cdot\vec{y} + \lambda\vec{y}\cdot\vec{x} + \lambda^2(\vec{y}\cdot\vec{y})\\ \\ &= \|\vec{x}\|^2 - 2\lambda(\vec{x}\cdot\vec{y}) + \lambda^2 \|\vec{y}\|^2 \\ \\ \displaystyle &= \|\vec{x}\|^2 - 2\left(\frac{\vec{x}\cdot\vec{y}}{\|\vec{y}\|^2}\right)(\vec{x}\cdot\vec{y}) + \left(\frac{\vec{x}\cdot\vec{y}}{{\|\vec{y}\|^2}}\right)^2 {\|\vec{y}\|^2}\\ \\ \displaystyle &= \|\vec{x}\|^2 - 2\left(\frac{(\vec{x}\cdot\vec{y})^2}{\|\vec{y}\|^2}\right) + \frac{\left(\vec{x}\cdot\vec{y}\right)^2}{\|\vec{y}\|^2}\\ \\ &= \|\vec{x}\|^2 - \frac{\left(\vec{x}\cdot\vec{y}\right)^2}{\|\vec{y}\|^2} \end{array}
Daraus folgt:
\displaystyle 0 \leq \|\vec{x}\|^2 - \frac{\left(\vec{x}\cdot\vec{y}\right)^2}{\|\vec{y}\|^2}
Und daher:
\left(\vec{x}\cdot\vec{y}\right)^2 \leq \|\vec{x}\|^2 \|\vec{y}\|^2
Und schließlich, durch Wurzelziehen, erhält man die gewünschte Aussage:
|\vec{x}\cdot\vec{y}| \leq \|\vec{x}\| \|\vec{y}\| ⬛
Dreiecksungleichung
Seien \vec{x},\vec{y}\in\mathbb{R}^n, dann erfüllen diese Vektoren die folgende Beziehung:
\|\vec{x} + \vec{y}\| \leq \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|
BEWEIS:
Beachten wir zunächst:
\begin{array}{rl} \|\vec{x} + \vec{y}\|^2 &= (\vec{x} + \vec{y})\cdot(\vec{x} + \vec{y}) \\ \\ &=\|\vec{x}\|^2 + 2(\vec{x}\cdot\vec{y}) + \|\vec{y}\|^2 \end{array}
Da folgende Beziehungen gelten:
\vec{x}\cdot\vec{y}\leq |\vec{x}\cdot\vec{y}| \leq \|\vec{x}\|\vec{y}\|
Können wir schreiben:
\begin{array}{rl} \|\vec{x} + \vec{y}\|^2 &\leq \|\vec{x}\|^2 + 2\|\vec{x}\|\|\vec{y}\| + \|\vec{y}\|^2 \\ \\ &\leq \left(\|\vec{x}\| + \|\vec{y}\| \right)^2 \end{array}
Schließlich ergibt sich durch Wurzelziehen die zu beweisende Aussage:
\|\vec{x} + \vec{y}\|\leq \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\| ⬛
Fazit
Im Verlauf dieser Lektion haben wir die grundlegenden Eigenschaften des euklidischen Raums \mathbb{R}^n untersucht und dabei seine algebraischen und metrischen Strukturen behandelt. Wir begannen mit der Definition seiner Grundoperationen wie der Vektoraddition und dem Skalarprodukt und legten damit seinen Charakter als Vektorraum fest. Anschließend vertieften wir das Konzept des Skalarprodukts und seine Bedeutung für die Geometrie von \mathbb{R}^n, wobei wir besonders auf die matrixartige Darstellung und die Verbindung zu linearen Abbildungen eingegangen sind.
Daraufhin analysierten wir die euklidische Norm und die durch sie induzierte Distanz und hoben hervor, wie uns diese Werkzeuge ermöglichen, Längen und Abstände in diesem Raum zu quantifizieren. Zudem betrachteten wir grundlegende Eigenschaften wie die Cauchy-Schwarz-Ungleichung:
|\vec{x}\cdot\vec{y}| \leq \|\vec{x}\| \|\vec{y}\|
und die Dreiecksungleichung:
\|\vec{x} + \vec{y}\|\leq \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|
welche für die Entwicklung weiterführender Theorien in der Analysis und Geometrie von zentraler Bedeutung sind.