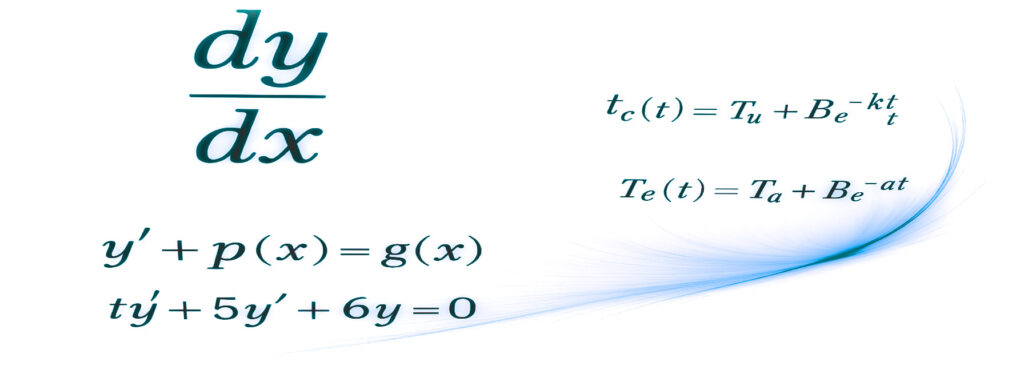Einführung in die gewöhnlichen Differentialgleichungen
In dieser Lehrveranstaltung wird eine detaillierte Untersuchung der grundlegenden Ideen, die diese Gleichungen bestimmen, und ihrer Anwendungen in verschiedenen Bereichen angeboten. Beginnend mit einer Analyse der Natur des unaufhörlichen Wandels in der uns umgebenden Welt werden grundlegende Konzepte wie Funktionen, Ableitungen und deren Verhältnis zum kontinuierlichen und diskreten Wandel vorgestellt. Es wird die Unterscheidung zwischen partiellen Differentialgleichungen (PDG) und gewöhnlichen Differentialgleichungen (GDG) eingeführt, wobei der Schwerpunkt auf dem Studium der GDG liegt. Konzepte werden anhand praktischer Beispiele wie dem Abkühlen einer Tasse Kaffee, den Newtonschen Gesetzen und Populationsmodellen illustriert. Die Studierenden haben die Gelegenheit, sich mit Differentialgleichungen vertraut zu machen, die natürliche und physikalische Phänomene regeln, zu entdecken, wie sie mathematisch dargestellt werden können, und einige Techniken zum Studium ihrer Lösungen zu verstehen. Dieses anfängliche Wissen bildet die Grundlage für weiterführende Studien über Differentialgleichungen und deren Anwendungen in Wissenschaft und Ingenieurwesen..
Lernziele:
Am Ende dieser Unterrichtseinheit wird der Student in der Lage sein:
- Verstehen der grundlegenden Konzepte im Zusammenhang mit Differentialgleichungen, wie die Natur des Wandels, Funktionen, Ableitungen und die Unterschiede zwischen partiellen Differentialgleichungen (PDG) und gewöhnlichen Differentialgleichungen (GDG)
INHALT
Differentialgleichungen und die Natur der Dinge
Der unablässige Wandel
Funktionen, Ableitungen und ihre Änderungen
GDG und PDG
Beispiele gewöhnlicher Differentialgleichungen
Das Abkühlen einer Tasse Kaffee
Die Newtonschen Gesetze
Bevölkerungsmodell
Differentialgleichungen und die Natur der Dinge
Der unablässige Wandel
In der Natur befindet sich alles in ständigem Wandel. Selbst das, was niemals zu ändern scheint, wie der Glanz der Sonne, variiert, wenn man auf der richtigen Zeitskala betrachtet. Alles verändert sich: der Glanz der Sterne, die Temperatur des Kaffees in einer Tasse, die Position eines Objekts und die Größe einer Population sind einige Beispiele, und diese Änderungsraten stehen im Allgemeinen in Beziehung zum Zustand dessen, was sich ändert, während diese Änderung stattfindet.
Eine intuitive Art, den Wandel zu verstehen, besteht darin, zu beobachten, wie sich die Dinge im Laufe der Zeit verändern. Die Veränderung, die in Bezug auf die Zeit geschieht, nennen wir Evolution, und alles, was wir beobachten können, befindet sich in ständiger Evolution. Aber Evolution ist nicht die einzige Form des Wandels; zum Beispiel kann unsere Höhe über dem Meeresspiegel im Laufe der Zeit variieren, aber es ist wahrscheinlicher, dass sie sich je nach unserer Position (oder geografischen Koordinaten) ändert.
Funktionen, Ableitungen und ihre Veränderungen
Allgemeiner ausgedrückt, eine Funktion mehrerer Variablen f(x_1,x_2, \cdots, x_n) kann sich ändern, wenn eine ihrer Variablen sich ändert, und diese Veränderung kann kontinuierlich oder diskret sein. Für eine Funktion mehrerer Variablen kann der kontinuierliche Wandel durch partielle Ableitungen: untersucht werden:
\displaystyle \frac{\partial f(x_1, \cdots, x_n)}{\partial x_1} = \lim_{\Delta x_1 \to 0} \frac{ f(x_1 + \Delta x_1, \cdots, x_n) - f(x_1, \cdots, x_n)}{\Delta x_1}
Wenn die Funktion eine einzige Variable hat, wird die gewöhnliche Ableitung: verwendet:
\displaystyle \frac{df(x)}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{ f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}
Wenn die Änderung diskret statt kontinuierlich ist, wird die Berechnung des Grenzwerts, der in den Ableitungen erscheint, einfach weggelassen.
GDG und PDG
Eine Gleichung, die eine Funktion und ihre verschiedenen Ableitungen enthält wird als Differentialgleichung bezeichnet. Wenn diese Ableitungen partiell oder gewöhnlich sind, werden sie entsprechend als partielle Differentialgleichungen (PDG) bzw. gewöhnliche Differentialgleichungen (GDG) bezeichnet. Im Folgenden konzentrieren wir uns auf das Studium gewöhnlicher Differentialgleichungen und werden einige Beispiele betrachten, in denen sie auftreten.
Beispiele gewöhnlicher Differentialgleichungen
Das Abkühlen einer Tasse Kaffee
Die Abkühlgeschwindigkeit einer Tasse Kaffee ist proportional zur Temperaturdifferenz zwischen der Umgebung und dem Kaffee. Wenn die Lufttemperatur, T_a, konstant ist und die Temperatur des Kaffees eine Funktion der Zeit T_c=T_c(t), ist, können wir eine Differentialgleichung finden, die uns erlaubt, die Temperatur des Kaffees zu jedem Zeitpunkt zu bestimmen. Anfangs haben wir:
\displaystyle \frac{dT_c(t)}{dt} = -\alpha^2(T_c(t) - T_a)
Dabei \alpha eine Proportionalitätskonstante ist, T_a \lt T_c(t) und das negative Vorzeichen anzeigt, dass die Temperatur des Kaffees abnimmt. Später werden wir sehen, dass diese Gleichung eine Lösung der Form hat:
T_c(t) = T_a + Be^{-\alpha^2 t}
Dabei B eine zu bestimmende Konstante ist.
Die Newtonschen Gesetze
Das zweite Newtonsche Gesetz ist im Wesentlichen eine gewöhnliche Differentialgleichung, denn in der Gleichung F=ma (Kraft gleich Masse mal Beschleunigung) ist die Beschleunigung, a=d^2x(t)/dt^2,, die zweite zeitliche Ableitung der Position des Objekts. Durch dieses Gesetz können wir Beziehungen finden, die die Bewegung von Körpern beschreiben, die in Wirklichkeit Differentialgleichungen sind. Ein einfaches Beispiel ist die Untersuchung von Federn: Wenn wir eine Feder haben, die auf der einen Seite an einer festen Wand und auf der anderen an einer Masse in Gleichgewichtslage befestigt ist, und wir dann die Masse um eine Strecke x aus dieser Position verschieben, wird die Masse nach dem Hookeschen Gesetz eine Rückstellkraft F=-kx erfahren. Dann haben wir nach dem zweiten Newtonschen Gesetz:
\displaystyle -kx(t) = m\frac{d^2x(t)}{dt^2}
Später werden wir feststellen, dass seine Lösung von der Form ist:
\displaystyle x(t) = A\sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \phi \right)
Dabei A und \phi Konstanten sind, die durch die Anfangsbedingungen des Problems bestimmt werden.
Bevölkerungsmodell
Die Wachstumsrate pro Einwohner einer Population ist gleich der Differenz zwischen der Geburten- und Sterberate, das heißt:
\displaystyle \frac{1}{x(t)} \frac{dx(t)}{dt} = N - M
Wenn die Geburtenrate N im Laufe der Zeit konstant bleibt und die Sterbefälle proportional zur Bevölkerung sind, das heißt M=\alpha^2 x(t),, dann nimmt die obige Gleichung die Form an:
\displaystyle \frac{dx(t)}{dt} = x(t) (N - \alpha^2 x(t))
Dies ist als „logistische Gleichung der Populationen“ bekannt. Aus dieser Gleichung kann eine Verallgemeinerung für viele Populationen x_1(t), x_2(t), \cdots, x_n(t) konstruiert werden, die wie folgt miteinander um das Überleben konkurrieren:
\displaystyle \frac{dx_i(t)}{dt} = x_i(t) \left(N_i - \displaystyle \sum_{j=1}^n\alpha^2_{ij} x_j(t) \right)
mit i\in\{1,\cdots, n\}. Dies ist das, was als Lotka-Volterra-Gleichungen bekannt ist.
Schlussfolgerung
Im Laufe dieser Einführung in die gewöhnlichen Differentialgleichungen haben wir untersucht, wie die Mathematik die Veränderungen, die in der natürlichen Welt stattfinden, präzise und elegant erfassen kann. Vom Abkühlen einer Tasse Kaffee über die Bewegung einer Feder bis hin zum Wachstum einer Population ermöglichen es GDG, komplexe Dynamiken in verständliche und analysierbare mathematische Beziehungen zu übersetzen.
Das Verständnis der Struktur und der Bedeutung dieser Gleichungen öffnet die Tür zu vielen Disziplinen wie Physik, Biologie, Wirtschaft und Ingenieurwesen. Dieser Kurs legt die notwendigen konzeptionellen Grundlagen, um mit weiterführenden Studien fortzufahren, in denen Lösungstechniken, qualitative Analyse und numerische Methoden vertieft werden. Am wichtigsten ist jedoch, dass eine anfängliche Intuition darüber entwickelt wurde, wie die Sprache des Wandels – die Differentialgleichungen – es uns ermöglicht, das Verhalten dynamischer Systeme zu beschreiben, zu verstehen und vorherzusagen.
In den folgenden Kursen werden wir weiterhin leistungsfähigere Werkzeuge entwickeln und sie auf neue Kontexte anwenden. Differentialgleichungen bieten uns nicht nur eine Möglichkeit, die Realität zu analysieren, sondern auch uns vorzustellen, wie sie sich unter verschiedenen Bedingungen entwickeln könnte.